Dieser Newsletter widmet sich der EU-Entgelttransparenzrichtlinie – einem Rechtsakt, der den Grundsatz, dass Männer und Frauen für gleiche oder gleichwertige Arbeit das gleiche Entgelt erhalten sollen, stärken soll. Sie erhalten Informationen zum Hintergrund und den Grundlagen der Richtlinie, den Neuerungen sowohl für Arbeitgeber- als auch Arbeitnehmer, insbesondere den Berichtspflichten, zur gerichtlichen Durchsetzung von Ansprüchen, der Berücksichtigung von Datenschutz und Tipps für die optimale Vorbereitung Ihres Unternehmens.
Auch auf nationaler Ebene herrscht im Arbeitsrecht reges Treiben: das Kilometergeld für Motor- und Fahrräder wurde gesenkt, und eine neue Teilpension und mehr Rechte für freie Dienstnehmer wurden beschlossen.
Im nächsten halben Jahr stehen wieder einige Seminare mit Frau Mag Unger vor der Tür.

1. Die Entgelttransparenzrichtlinie
1.1. Hintergrund
Die Entgelttransparenzrichtlinie (Richtlinie (EU) 2023/970, idF: ETRL) ist am 06.06.2023 in Kraft getreten. Ihr Ziel ist die geschlechtsneutrale Entgeltgleichheit, dh die Entlohnung unabhängig vom Geschlecht.
Bereits im Jahr 1957 wurde der Grundsatz, dass Männer und Frauen für gleichwertige Arbeit auch das gleiche Entgelt erhalten sollen, im europäischen Primärrecht verankert. Seit 1979 haben wir mit dem Gleichbehandlungsgesetz auch in Österreich eine nationale Grundlage dafür. Aufgrund der unzureichenden Wirkung dieser Gesetze, wurde die ETRL verabschiedet, welche zur Schließung des Gender Pay Gap maßgebend beitragen soll. Diese ist von den EU-Mitgliedstaaten bis 07.06.2026 umzusetzen. Im August 2025 liegt noch kein nationaler Gesetzesentwurf vor.
1.2. Allgemeines

1.2.1. Anwendungsbereich
Der persönliche Anwendungsbereich umfasst Arbeitnehmer:innen (AN) und in bestimmten Fällen auch bereits Stellenwerber:innen und Arbeitgeber:innen (AG). Die ETRL stellt dabei auf den autonomen AN-Begriff des Unionsrechts ab. Damit sind zB auch öffentlich-rechtliche Beamtenverhältnisse, weisungsgebundene Mitglieder der Organe von Kapitalgesellschaften und leitende Angestellte vom Anwendungsbereich erfasst.
Auf AG-Seite werden sowohl AG im privaten als auch im öffentlichen Sektor verpflichtet, wobei gewisse Vorschriften an bestimmte Beschäftigungszahlen geknüpft werden können.
Sachlich bezieht sich die RL auf das Entgelt, welches in Art 3 Abs 1a ETRL auch eigens definiert wird:
„die üblichen Grund- oder Mindestlöhne und -gehälter sowie alle sonstigen Vergütungen, die ein Arbeitgeber aufgrund des Dienstverhältnisses einem Arbeitnehmer unmittelbar oder mittelbar (…) als Geld- oder Sachleistung zahlt"
→ Der Begriff des Entgelts ist sehr weit zu verstehen.
1.2.2. Vergütungskriterien
Die Beurteilung, ob ein Entgeltgefälle zwischen den Geschlechtern herrscht, soll auf Grundlage von objektiven, geschlechtsneutralen Kriterien durchgeführt werden. Um das Recht auf gleiches Entgelt für gleiche oder gleichwertige Arbeit zu gewährleisten, müssen AG daher bestimmte Vergütungsstrukturen schaffen.
Eine Herausforderung kann insb die Bewertung gleichwertiger Arbeit sein. Die zu schaffende Vergütungsstruktur muss es nämlich ermöglichen, den Wert unterschiedlicher Aufgaben innerhalb derselben Organisationsstruktur (= gleichwertige Arbeit)zu vergleichen. Die für die Vergütungsstruktur zu verwendenden Kriterien müssen jedenfalls folgende vier Faktoren umfassen:
Kompetenzen
Belastungen
Verantwortung
Arbeitsbedingungen
Zusätzlich können bzw müssen weitere Kriterien, wie berufliche Anforderungen oder Bildungsanforderungen, hinzugezogen werden. Insbesondere relevante soziale Kompetenzen müssen berücksichtigt werden.
1.2.3. AN-Gruppen
Die Umsetzung der ETRL erfordert ua eine Einteilung der AN in Gruppen, in welchen gleiche oder gleichwertige Arbeit verrichtet wird. Diese Gruppen sind vom AG, uU zusammen mit AN-Vertretern (Betriebsrat) einzuteilen. Die Art und Weise wie dies zu geschehen hat, ist nicht genau vorgegeben. Folgendes kann jedoch beachtet werden:
Kollektivverträge treffen Unterscheidungen zwischen Verwendungsgruppen. Findet eine Bezahlung gem Kollektivvertrag statt und beruht die Abgrenzung zwischen den Verwendungsgruppen im jeweiligen Kollektivvertrag auf objektiven und geschlechtsneutralen Kriterien (Kompetenzen, Belastungen, Verantwortung, Arbeitsbedingungen), so kann dieser Kollektivvertrag bei der Bildung der AN-Gruppen als Orientierung und Hilfsmittel herangezogen werden. Der EuGH hat jedoch bereits mehrfach entschieden, dass der Verweis auf die Tätigkeitsgruppe gem Kollektivvertragallein nicht ausreichend ist.
Findet eine Überzahlung des kollektivvertraglichen Entgelts statt, ist die konsequente Bildung von Vergütungsstrukturen umso wichtiger. In ihnen müssen die Kriterien für die Gewährung der Überbezahlung objektiv und geschlechtsneutral dargestellt werden.
1.3. Auswirkungen

Sowohl für AG als auch AN wird sich einiges verändern. Insbesondere aus Sicht von Unternehmen und ggf ihren HR-Teams, besteht jedoch Handlungsbedarf.
1.3.1. Informations- und Auskunftsrechte
AN und Stellenwerber:innen erhalten durch die ETRL Informations- und Auskunftsrechte.
Da diese Rechte zT bereits vor Begründung des Arbeitsverhältnisses bestehen (Art 5 ETRL), müssen AG bestimmte Informationen bereits zum Zeitpunkt der Stellenausschreibung oder des Vorstellungsgespräches bereitstellen. Folgendes gilt es zu beachten:
Stellenwerber:innen haben ein Recht auf Information über das auf objektiven, geschlechtsneutralen Kriterien beruhende Einstiegsentgelt für die betreffende Stelle bzw dessen Spanne.
Ggf muss auch die einschlägige Bestimmung des anzuwendenden Kollektivvertrags angegeben werden.
Stellenwerber:innen dürfen nicht nach ihrem ehemaligen Entgelt oder Entgeltentwicklungen befragt werden.
Stellenausschreibungen und Berufsbezeichnungen müssen geschlechtsneutral sein und dürfen nicht diskriminieren.
Hinweis: Der in Stellenausschreibungen bereits gängige Zusatz „m/w/d“ entspricht der geschlechtsneutralen Stellenausschreibung. |
Während aufrechtem Arbeitsverhältnis haben AN zusätzlich Auskunftsrechte (Art 7 ETRL) über ihre individuelle Entgelthöhe und über die durchschnittlichen Entgelthöhen. Diese Ansprüche bestehen unabhängig davon, wie viele AN der AG beschäftigt. Die Information muss
in schriftlicher Form und
aufgeschlüsselt nach Geschlecht und AN-Gruppen, die gleiche oder gleichwertige Arbeit verrichten,
innerhalb von zwei Monaten
vom AG bereitgestellt werden.
Eine Anforderung über AN-Vertreter oder einer Gleichbehandlungsstelle ist ebenso möglich. AN müssen vom AG jährlich proaktiv über diese Auskunftsrechte informiert werden. Sind die Ausführungen mangelhaft, besteht ein Recht auf zusätzliche Klarstellung und Begründung.
1.3.2. Transparenzpflichten
AG müssen ihre AN proaktiv über ihre objektiven und geschlechtsneutralen Kriterien zur Festlegung des Entgelts informieren. Allgemeine Informationen zu den geltenden Kriterien im Unternehmen sind nicht ausreichend – die Angaben sollten auf die einzelnen AN-Gruppen zugeschnitten sein. Wie diese Kriterien angewendet werden oder Berechnungen stattfinden muss nicht Teil der Information sein.
Hinweis: Für Kleinstunternehmen mit weniger als 50 AN sind einige Erleichterungen vorgesehen. Sie können von der Verpflichtung ausgenommen werden und zur Minimierung des Verwaltungsaufwandes sind ihnen gebrauchsfertige Vorlagen zur Verfügung zu stellen. |
Wird die Transparenzpflicht verletzt, steht den AN ein Schadenersatzanspruch zu.
1.3.3. Berichtspflichten
Nach § 11a GlBG gibt es in Österreich für bestimmte Unternehmen ab 150 Beschäftigten bereits die Verpflichtung, einen Einkommensbericht zu erstellen. Die Regelungen der ETRL gehen jedoch darüber hinaus und werden auch in Österreich zu einer Änderung der Rechtslage führen.
Die Berichterstattung gem Art 9 ETRL richtet sich danach, wie viele AN im Unternehmen beschäftigt sind:
Ab 2027 und danach alle drei Jahre besteht eine Berichtspflicht für Unternehmen ab 150 AN.
AG mit 250 AN oder mehr sind ab 2027 verpflichtet, jährlich einen Einkommensbericht vorzulegen.
Ab 2031 und danach alle drei Jahre müssen auch Unternehmen mit 100 bis 149 AN einen Einkommensbericht vorlegen.
Für Unternehmen mit weniger als 100 AN besteht gem ETRL keine Berichtspflicht, jedoch können nationale Gesetze eine solche vorsehen.
In Österreich sind Verpflichtete gem § 11a GlBG bereits zu einer Berichterstattung im Abstand von zwei Jahren verpflichtet. Aufgrund des Verschlechterungsverbots wird dieses Intervall nicht auf drei Jahre verlängert werden.
Der Bericht muss folgende Informationen enthalten:
Informationen zum „geschlechtsspezifischen Entgeltgefälle“ = die Differenz zwischen der durchschnittlichen Entgelthöhe der Männer und jener der Frauen
Dabei ist auf das Bruttojahresentgelt abzustellen.
Die Ermittlung hat für das gesamte Unternehmen und für die einzelnen AN-Gruppen stattzufinden.
Informationen zum „mittleren geschlechtsspezifische Entgeltgefälle“ = die Differenz zwischen der Median-Entgelthöhe der Männer und jener der Frauen
Die Median-Entgelthöhe entspricht jenem Bruttojahresentgelt, von dem aus gesehen die Zahl der AN mit höherem Entgelt gleich ist wie die Zahl der AN mit geringerem Entgelt.
Ermittlung nur für das gesamte Unternehmen
Hinweis: Sowohl das „geschlechtsspezifische“ als auch das „mittlere geschlechtsspezifische“ Entgeltgefälle ist zweimal auszuweisen: für das feste Grundentgelt und für die ergänzenden oder variablen Entgeltbestandteile (zB Bonuszahlungen, Überstundenentgelt usw) |
Angabe über den Anteil der Männer und Frauen, die „ergänzende oder variable Bestandteile“ erhalten
Einteilung der AN nach ihrer jeweiligen Entgelthöhe in aufsteigender Reihenfolge in vier gleich große Gruppen („Entgeltquartile“) und Angabe des Anteiles von Männer und Frauen in jedem Entgeltquartil
Der Bericht muss den Beschäftigten, den AN-Vertretern und der von den Mitgliedstaaten zu schaffenden Überwachungsstelle mitgeteilt werden. Unternehmen können den Bericht auch im Internet veröffentlichen, um mit ihren geschlechtergerechten Entgeltstrukturen zu werben („Employer-Branding“). Dabei ist zu beachten, dass die Angaben zum Entgeltgefälle in den einzelnen AN-Gruppen nicht veröffentlicht werden dürfen.
1.3.4. Gemeinsame Entgeltbewertung
Je nachdem, welches Ergebnis der Bericht gem Art 9 ETRL hervorbringt, folgen uU bestimmte Maßnahmen der Gemeinsamen Entgeltbewertung (Art 10 ETRL):
Bei einem geschlechtsspezifischen Entgeltgefälle von mind 5 % in einer AN-Gruppe,
das der AG nicht auf Grundlage von objektiven und geschlechtsneutralen Kriterien rechtfertigen kann
und welches nicht binnen sechs Monaten korrigiert wird,
müssen AG und AN-Vertreter eine „gemeinsame Entgeltbewertung“ durchführen.
Ziel dieser gemeinsamen Entgeltbewertung soll sein, herauszufinden, warum das Entgeltgefälle besteht und welche Maßnahmen zur Beseitigung ergriffen werden müssen. AG müssen diese gemeinsame Entgeltbewertung den AN sowie der jeweiligen staatlichen Überwachungsstelle zu Verfügung stellen.
1.4. Gerichtliche Durchsetzung

Einige Regelungsinhalte der ETRL zur Rechtsdurchsetzung kennt das österreichische Recht bereits – hier besteht wenig Anpassungsbedarf:
Ansprüche von AN können, uU auch mit Hilfe von Verbänden oder Gleichbehandlungsstellen, gerichtlich durchgesetzt werden, wobei bestimmte Beweislasterleichterungen zu beachten sind: AG müssen nachweisen, dass eine Entgeltdiskriminierung nicht vorliegt – AN müssen eine Entgeltdiskriminierung nur glaubhaft machen.
AN, die ihre Rechte ausgeübt oder eine andere Person dabei unterstützt haben, dürfen deshalb nicht benachteiligt werden (Benachteiligungsverbot)
Schadenersatz im Falle eines erlittenen Schadens, wobei es keine vorab definierte betragliche Obergrenze gibt
Neu bzw verschärft wird folgendes sein:
Die Beweislasterleichterung wird zu einer gesetzlich vorgeschriebenen Beweislastumkehr.
AG könne durch Behörden und Gerichte dazu verpflichtet werden, einschlägige Beweismittel offenzulegen.
Beim Nachweis gleicher oder gleichwertiger Arbeit gibt es keine Beschränkung auf Personen, die für denselben AG oder zur gleichen Zeit beschäftigt sind – der Kreis möglicher Vergleichspersonen wird also größer.
Verjährungsfristen müssen mind drei Jahre betragen. Sie beginnen nicht vor Kenntnis des AN von einem Verstoß zu laufen.
Bei der Beurteilung der Verfahrenskosten nach Obsiegen des AG muss beurteilt werden, ob der AN berechtigte Gründe für die Klage hatte. Dies kann sich auf die Kostentragung auswirken.
Für Verstöße gegen Gesetze, die den Grundsatz der Entgeltgleichheit verwirklichen sollen, sind „wirksame, verhältnismäßige und abschreckende“ Sanktionen vorgesehen.
→ Wie diese Sanktionen genau aussehen werden, kann erst nach Veröffentlichung eines nationalen Gesetzesentwurfs beurteilt werden, es wird sich jedoch primär um Geldstrafen handeln.
1.5. Datenschutzrechtliches

Die ETRL verweist iZm der Verarbeitung personenbezogener Daten grundsätzlich auf die Datenschutz-Grundverordnung. Personenbezogene Daten, die im Zuge von individuellen Auskunftsrechten, Berichtspflichten oder der gemeinsamen Entgeltbewertung verarbeitet werden, dürfen für keine anderen Zwecke verwendet werden.
Daten zu ehemaligen Entgeltentwicklungen von Stellenwerber:innen dürfen nicht erhoben werden. Bei einem Verstoß dieses Verbots durch AG, sind Bewerber:innen zu bewusst wahrheitswidrigen Angaben berechtigt.
Beschäftigte müssen berechtigt sein ihr Gehalt offenzulegen – dies darf AN insb nicht vertraglich untersagt werden. Informationen die AN über das Entgelt anderer Personen erhalten, dürfen hingegen nur verwendet werden, um einen Anspruch auf gleiches Entgelt durchzusetzen.
In bestimmten Fällen steht es den Mitgliedstaaten bei der Umsetzung frei, die Offenlegung zu beschränken: Bei Offenlegungen von Informationen aufgrund von Auskunftsrechten, Berichtspflichten oder der gemeinsamen Entgeltbewertung, die zur unmittelbaren oder mittelbaren Offenlegung des Entgelts eines AN führen würden, können die Mitgliedstaaten beschließen, dass die Informationen nur für AN-Vertreter bzw die Gleichbehandlungsstelle einsehbar sind.
→ Wie der nationale Gesetzgeber diesbezüglich entscheidet, kann erst nach Veröffentlichung eines Gesetzesentwurfs beurteilt werden.
1.6. To-Do's für Arbeitgeber:innen
Analyse der vorhandenen Vergütungsstruktur im Unternehmen Gibt es eine Vergütungsstruktur? Entspricht diese den Anforderungen der ETRL? Wo besteht ggf Anpassungsbedarf? Wer verdient wie viel für welche Arbeit? |
Identifikation der AN-Gruppen Wo wird gleiche oder gleichwertige Arbeit geleistet? Wo liegen evt Unstimmigkeiten vor? |
Auswertung der vorgenommenen Analyse Was sind die Gründe für einen allfälligen Gender Pay Gap? Welche Rechtfertigungsmöglichkeiten bestehen und welche Dokumente sind dafür notwendig? |
Bildung einer Vergütungsstruktur, die transparent ist und der ETRL entspricht Betriebsrat, Rechtsberatung und/oder Steuerberatung (falls vorhanden) können miteinbezogen werden. |
Erstellung von Rahmenbedingungen für die interne Kommunikation und Kontrolle |
Richtlinienkonforme Durchführung von Bewerbungsprozessen Entsprechen Stellenausschreibungen den Anforderungen der ETRL? Müssen Leitfäden für Bewerbungsgespräche evt überarbeitet werden? Ist eine Schulung des Personals notwendig? |
Konsequente und genaue Dokumentation von Entgeltfragen |
2. Verbesserung der Rechtsstellung freier Dienstnehmer
2.1. Allgemeines
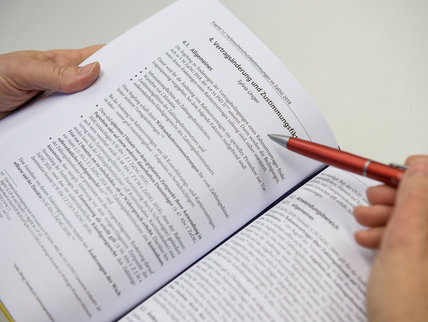
Der freie Dienstvertrag gewinnt in der Arbeitswelt immer mehr an Bedeutung - er zeichnet sich dadurch aus, dass das wesentliche Merkmal eines Arbeitsvertrages, die persönliche Abhängigkeit, fehlt. Ein freier Dienstnehmer ist nicht an Weisungen des Dienstgebers, insb hinsichtlich Arbeitszeit und -ort gebunden und kann sich seine Arbeit selbständig regeln und einteilen.
Für freie Dienstverträge gelten grundsätzlich nur die allgemeinen vertragsrechtlichen Bestimmungen des ABGB. Insbesondere arbeitsrechtliche Normen, deren Zweck es oft ist, die sozial schwächere Partei zu schützen, kommen nicht zur Anwendung.
Durch eine Gesetzesnovelle sollen nun
eigene Kündigungsregelungen für freie Dienstnehmer und
die Möglichkeit, einen Kollektivvertrag auch für freie Dienstnehmer abzuschließen
geschaffen werden.
Ein Ministerialentwurf (Link) wurde am 29.07.2025 veröffentlicht. Die neuen Regelungen sollen für freie Dienstverträge gelten, die ab dem 01.01.2026 abgeschlossen werden. Bestehende Verträge bleiben von den neuen Regelungen unberührt.
2.2. Was bringt die neue Gesetzesnovelle?
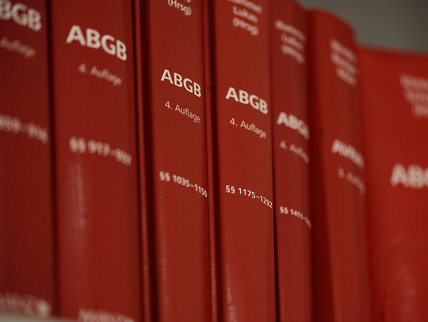
2.2.1. Kündigungsregelung
§ 1159 ABGB enthält Regelungen zur Kündigung von Dauerschuldverhältnissen. Die Bestimmung gibt es in dieser Form erst seit 2021. Das Ziel der damaligen Neufassung war die Beseitigung der Ungleichbehandlung von Arbeitern und Angestellten, weshalb die Bestimmung an den für Angestellte geltenden § 20 AngG angepasst wurde.
Mit Urteil vom 27.02.2025 entschied der OGH, dass die Bestimmungen des § 1159 ABGB auf freie Dienstverhältnisse nicht anwendbar sind, da es sich um eine soziale Schutzbestimmung handelt, die nur aufgrund eines persönlichen Abhängigkeitsverhältnisses notwendig ist – ein solches ist beim freien Dienstverhältnis jedoch nicht gegeben.
Damit beide Vertragspartner die Möglichkeit der Kündigung haben, schafft die Novelle nun den neuen § 1159 Abs 6 ABGB, wonach ein freies Dienstverhältnis von beiden Vertragspartner unter Einhaltung der gesetzlich festgelegten Mindestfrist von vier Wochen zu den festgelegten Kündigungsterminen (zum 15. oder Letzten eines Kalendermonats) gekündigt werden kann. Nach vollendetem zweitem Dienstjahr erhöht sich die Kündigungsfrist auf sechs Wochen.
Auch die Vereinbarung einer Probezeit im ersten Monat des freien Dienstverhältnisses wird möglich – in diesem Zeitraum ist eine Auflösung des Dienstverhältnisses jederzeit von beiden Seiten möglich.
Eine Aufhebung oder Beschränkung dieser Regelungen ist nicht zulässig, abweichende Bestimmungen zugunsten der freien Dienstnehmer sind jedoch möglich.
2.2.2. Abschlussmöglichkeit eines Kollektivvertrages
In Zukunft soll der Abschluss eines Kollektivvertrages auch für freie Dienstnehmer möglich sein. Damit sollen kollektivvertragliche Mindeststandards auch für freie Dienstnehmer zugänglich werden.
Es soll sowohl der Abschluss eigener Kollektivverträge mit der Personengruppe der freien Dienstnehmer allein als auch die Einbeziehung der freien Dienstnehmer in den Geltungsbereich bestehender Kollektivverträge möglich sein.
Achtung: Nehmen Bestimmungen im Kollektivvertrag Bezug auf Gesetze in dessen Geltungsbereich freie Dienstnehmer nicht fallen (zB Urlaubsgesetz, Arbeitszeitgesetz), ist die jeweilige Bestimmung auf freie Dienstnehmer nicht anwendbar! Sollen die gleichen Bestimmungen gelten, müssen diese im Kollektivvertrag für die freien Dienstnehmer nachgebildet werden. |
3. Teilpension ab 2026

Ab dem 1. Jänner 2026 gibt es aufgrund des im Juli 2025 im Nationalrat beschlossenen „Teilpensionsgesetzes“ eine neue Möglichkeit, schrittweise in den Ruhestand zu gehen: die Teilpension. Ziel der Teilpension ist, einen gleitenden Übergang zwischen Erwerbsleben und Pension zu ermöglichen, unter gleichzeitiger Erhöhung des Pensionsantrittsalters.
3.1. Wer kann die Teilpension in Anspruch nehmen?
Anspruchsberechtigt sind Personen, die grundsätzlich bereits eine Alterspension beziehen könnten. Diese sind:
die Korridorpension (ab 62 bzw. ab 2026 schrittweise ab 63 Jahren),
die Schwerarbeiterpension (ab 60),
die Langzeitversichertenpension („Hacklerregelung“, ab 62) oder
die reguläre Alterspension.
3.2. Teilzeit arbeiten, Teilpension beziehen
Voraussetzung ist eine Arbeitszeitreduktion zwischen 25 und 75 % mit Zustimmung des Arbeitgebers. Entsprechend der Arbeitszeitreduktion wird ein Teil des Pensionskontos geschlossen und von diesem geschlossenen Teil die Teilpension monatlich ausbezahlt:
25–40 % Reduktion | 25 % Teilpension |
41–60 % | 50 % Teilpension |
61–75 % | 75 % Teilpension |
Der verbleibende Teil des Pensionskontos wird durch die weitere Erwerbstätigkeit aufgewertet. Das führt wiederum zu einer Erhöhung der späteren Gesamtpension.
3.3. Teilpension: keine weitere Erwerbstätigkeit
Wer eine Frühpension nutzt, muss generell mit Abschlägen rechnen (z. B. 5,1 % pro Jahr vor dem Regelpensionsalter bei Korridorpension). Außerdem darf während der Teilpension keine weitere Erwerbstätigkeit aufgenommen werden, die eine Pflichtversicherung auslöst oder die Geringfügigkeitsgrenze überschreitet.
3.4. Einschränkung der Altersteilzeit
Parallel zur neuen Teilpension wird die bisherige Altersteilzeit reformiert. Ab 2026 wird Altersteilzeitgeld nur noch für drei statt fünf Jahre vor Pensionsantritt gewährt. Bis 2029 sind Übergangsregelungen zu beachten.
3.5. Fazit
Die Teilpension ist eine Möglichkeit, den Übergang in die Pension fließend zu gestalten. Durch die Inanspruchnahme der Teilpension kann vom längeren Verbleib im Arbeitsleben doppelt profitiert werden. Einerseits durch den sanften Übergang in die Pension und andererseits erhöht sich die Gesamtpension durch das längere Verbleiben im Arbeitsleben.
4. Kilometergeld ab 01. Juli 2025

Mit Jahresbeginn 2025 wurde das Kilometergeld für Motorräder und Mopeds sowie Fahrräder auf einheitlich 0,50 Euro pro Kilometer angehoben. Diese Erhöhung hatte nur kurze Dauer: Ergänzend zum Budgetbegleitgesetz 2025 wurde das BGBl I 26/2025 erlassen, welches ab 1. Juli 2025 wieder zu eine Senkung auf 0,25 Euro führte.
Was ändert sich konkret?
Fortbewegungsmittel | bis 30.06.2025 | ab 01.07.2025 |
Motorräder u. Mopeds | € 0,50 | € 0,25 |
PKW | 0,50 | 0,50 |
Mitbeförderungszuschlag pro Person | 0,15 | 0,15 |
Fahrrad | € 0,50 | € 0,25 |
Fußgeher | € 0,38 | € 0,38 |
Die jährliche Kilometerobergrenze bleibt allerdings bei:
30.000 km für Pkw und Motorräder,
3.000 km für Fahrräder und
die Mindestgrenze für Fußgänger liegt bei 1 km.
5. Seminare
5.1. Austrian Payment Academy/APAc – Grundkurse 2025 (hybrid)
Die APAc (Austrian Payment Academy) ist ein Ausbildungsangebot für alle, die im Zahlungsverkehr tätig sind oder einen umfassenden Einblick in die technologiegetriebene dynamische Payment Branche erhalten möchten. Frau Mag Unger trägt das Modul IV „Legal, Compliance“ vor und erläutert die rechtlichen Rahmenbedingungen des Zahlungsverkehrs. Der nächsten Grundkurse starten am 16.09.2025 und am 04.11.2025. Nähere Informationen unter https://paymentacademy.at/angebot.
5.2. Präsenzseminar: „Zahlungsverkehr, Zahlungsdienste, Zahlungskonto“
Von 17. – 18.11.2025 findet das Fachseminar "Zahlungsverkehr, Zahlungsdienste, Zahlungskonto! Neuerungen/aktuelle Entwicklungen sowie relevante zivilrechtliche Aspekte" des Finanzverlages statt. Nähere Informationen finden Sie hier: https://www.finanzverlag.at/events/zahlungsverkehr-zahlungsdienste-zahlungskonto/
5.3. Präsenzseminar: „Arbeitsrecht für Führungskräfte“
Am 18.02.2026 findet im Hotel Sans Souci Wien wieder das Präsenzseminar „Arbeitsrecht für Führungskräfte“, das für alle Branchen geeignet ist, statt. Nähere Informationen finden Sie hier: https://www.weka-akademie.at/arbeitsrecht-fur-fuhrungskrafte/